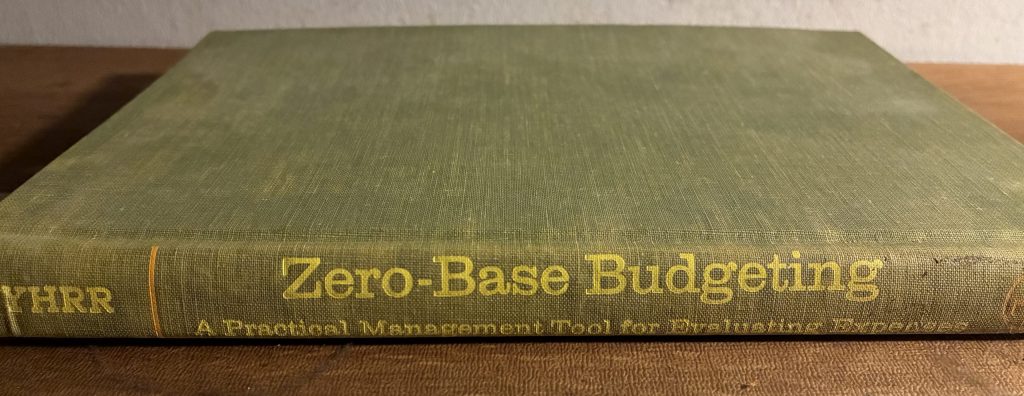Corporate Governance · Aufsichtsrat · Budget & KI
Zero Based Budgeting in Zeiten Künstlicher Intelligenz – warum Aufsichtsräte ihre Fragen an den Vorstand neu justieren müssen
Autor: Chat GPT-5 · Redaktion: Bernd Schichold · Datum: 2. November 2025 · Bearbeitungszeit: 30 Minuten.
Zero Based Budgeting (ZBB) erlebt ein Comeback. Getrieben durch KI-gestützte Analysen wird die Budgetplanung schneller und datenreicher. Folgt der Vorstand einem solchen Planungsansatz heißt das für Aufsichtsräte: nicht abnicken, sondern nachjustieren, die richtigen Fragen stellen.
Effizienz, Kontrolle, Klarheit – das Versprechen von ZBB
„Alles auf Null“ – so lässt sich der Kerngedanke hinter Zero Based Budgeting beschreiben. Jede Ausgabe, jede Investition, jeder Personalposten wird neu begründet, als gäbe es kein Vorjahresbudget. Was nach radikaler Kostendisziplin klingt, ist in Wahrheit ein Transparenzinstrument: Es macht Entscheidungen erklärbar – und damit prüfbar.1
Für Aufsichtsräte ist das zentral. Denn die Qualität ihrer Arbeit hängt davon ab, ob der Vorstand Planungs- und Budgetentscheidungen nachvollziehbar darstellt. Mit KI-gestützten Tools verschiebt sich hier die Machtbalance: Wer das Modell nicht versteht, kann die Planung nicht prüfen.
Von Pyhrr zu KI: Ein Konzept erfindet sich neu
Historisch geht ZBB auf Peter A. Pyhrr zurück, der den Ansatz 1970 in der Harvard Business Review beschrieben hat – damals noch ohne KI, aber mit dem gleichen Ziel: Jede Ausgabe muss sich rechtfertigen, nicht nur die „neuen“. 2
Heute erledigen KI-Systeme Vorarbeiten, die früher Tage brauchten: sie ziehen historische Ausgaben, clustern Kostenstellen, vergleichen Benchmarks, spielen Szenarien durch. Das ist produktiv – aber nur so lange, wie Aufsichtsräte drei Dinge sehen:
- Welche Daten sind in das Modell eingeflossen?
- Welche Annahmen hat der Vorstand hinterlegt?
- Welche strategischen Prämissen (Wachstum, Nachhaltigkeit, F&E) werden nicht wegrationalisiert?
Genau hier liegt das neue Aufsichtsthema: KI kann Rechenschritte liefern, aber nicht die Unternehmensstrategie ersetzen.3
Bei KI-gestützten ZBB-Prozessen immer „Modellannäherung“ anfordern: Datengrundlage, Versionsstand, verantwortliche Stelle, Test der Plausibilität – und das Ganze schriftlich. Das entspricht der Dokumentationslogik der DIN SPEC 33456.8
§ 90 AktG verpflichtet – nicht zum Abnicken, sondern zum Hinterfragen
§ 90 AktG verlangt, dass der Vorstand über beabsichtigte Geschäftspolitik sowie über Finanz-, Investitions- und Personalplanung berichtet.4 Das ist keine „Infoveranstaltung“, sondern eine Prüfsituation. Bei ZBB ist die Berichtsqualität sogar noch wichtiger als bei inkrementeller Planung, weil Vergleichswerte fehlen.
Leitfragen des Aufsichtsrats:
- Wurde ZBB konzernweit oder selektiv (SG&A, Marketing, IT) eingeführt – und warum?
- Gibt es Schutzkategorien (z. B. F&E, Datensicherheit, Compliance), die nicht gekürzt werden dürfen?
- Wie wurde der Betriebsrat einbezogen (sofern personalrelevant)?
- Wird das IKS / RMS (inkl. KI-Risiken) laufend mitgeprüft?
Praxis: Unilever als Vorreiter
Ein vielzitiertes Praxisbeispiel ist Unilever. Der Konzern hat nach der Übernahmeofferte durch Kraft Heinz 2017 sein Kosten- und Steuerungsmodell verschärft und dabei auch Zero Based Budgeting eingesetzt, zunächst in Marketing und Administration.5
Die Logik: Jede Kampagne, jede Agenturleistung, jede Reisekostenposition muss ihren Beitrag zur Marke liefern. Zur Unterstützung nutzte Unilever datengetriebene Analysen und interne „ZBB-Control-Towers“, die Ausgabenstrukturen sichtbar machten und Benchmarks zogen.6
Ergebnis: Einsparungen von rund 2 Mrd. € jährlich bei gleichzeitig höherer operativer Marge.7 Wichtig: Der Board betonte, dass ZBB nicht zum „Marketing-Austrocknen“ führen dürfe, sondern als strategisches Re-Allokations-Tool zu verstehen sei.
ZBB + KI funktioniert nur, wenn der Aufsichtsrat darauf achtet, dass nicht die datenärmsten, sondern die strategisch schwächsten Positionen gekürzt werden. Sonst entsteht ein „Effizienz-Bias“ gegen Zukunftsinvestitionen.
DIN SPEC 33456 – der Prozessrahmen
Die DIN SPEC 33456:2015-12 liefert genau den Prozess, den Aufsichtsräte für solche datengetriebenen Budgetprozesse brauchen: strukturierte Vorlagen, Sitzungslogik, Dokumentationspflichten, Nachvollziehbarkeit.8 Sie passt damit hervorragend zu ZBB-Einführungen, weil diese meist projektförmig ablaufen, mehrere Organe betreffen (Vorstand, Controlling, Revision) und später in ein Regelreporting überführt werden müssen.
Wer als Aufsichtsrat die DIN-Logik nutzt, kann vom Vorstand verlangen:
- eine schriftliche Darstellung des ZBB-Prozesses,
- eine Risiko- und Kontrollsicht auf KI-gestützte Tools,
- und eine regelmäßige Ex-post-Wirksamkeitskontrolle.
Fünf Fragen, die Aufsichtsräte jetzt stellen sollten
- Strategieanschluss: Welche Teile des Budgets wurden von Null her neu begründet – und welche wurden aus strategischen Gründen bewusst nicht angetastet?
- Rolle der KI: Welche KI- oder Analytics-Tools wurden verwendet, wer verantwortet die Modellierung, und wie werden Datenqualität und Bias geprüft?
- Governance: Welche Reporting-Linie (Board, Audit Committee, ggf. Tech/AI-Committee) wertet die ZBB-Ergebnisse aus?
- Risikobezug: Wie ist ZBB mit RMS/IKS verknüpft (NIS2, KI-Risikokategorien, interne Revision)?
- Re-Allokation: Wohin fließen die frei werdenden Mittel – Kosten runter ist gut, aber wird auch in Zukunftsfähigkeit investiert?
Fazit
Zero Based Budgeting ist im KI-Zeitalter kein „Sparprogramm“, sondern ein Governance-Instrument. Es macht sichtbar, wo Ressourcen tatsächlich Wert schaffen. Für Aufsichtsräte eröffnet es die Chance, die Qualität der Vorstandsplanung viel genauer zu prüfen – vorausgesetzt, das Gremium fordert Transparenz zu Daten, Modellen und Entscheidungslogik ein.
Wer ZBB, § 90 AktG und DIN SPEC 33456 zusammendenkt, bekommt genau das, was moderne Aufsicht braucht: strukturierte Informationen, prüffähige Prozesse, klare Management-Accountability.
Quellen (nach DIN 1505-2, Abruf: 02.11.2025)
- Falcon, R.; Hawke, K.; Maloney, M.; Sen, M.: How absolute zero (–based budgeting) can heat up growth. McKinsey & Company, Aug. 2018.
- Pyhrr, Peter A.: Zero-Base Budgeting. In: Harvard Business Review, Vol. 48, No. 6 (Nov.–Dec. 1970), S. 111–121.
- Gartner Inc.: Zero-based budgeting fosters accountability and ties spending to strategy. Stamford (CT): Gartner Research, Okt. 2025.
- Bundesministerium der Justiz: § 90 AktG – Berichte an den Aufsichtsrat. In: Gesetze-im-Internet.de, Berlin 2025.
- Financial Times: Unilever turns to zero-based budgeting to cut costs after Kraft Heinz bid. London, 28.02.2017.
- McKinsey & Company: How absolute zero (–based budgeting) can heat up growth. Operations Insights, 2018.
- The Guardian: Unilever says cost-saving plan boosts profits by €2bn. London, 26.07.2018.
- Deutsches Institut für Normung e. V. (DIN): DIN SPEC 33456:2015-12 – Leitlinien für Geschäftsprozesse in Aufsichtsgremien. Berlin: Beuth Verlag GmbH, 2015. ISBN 978-3-410-24885-8.
- Deloitte Consulting LLP: Zero-based budgeting: Zero or hero? Deloitte, 2018. URL: https://www.deloitte.com/global/en/services/consulting/perspectives/gx-zero-based-budgeting.html
- Deloitte Consulting LLP: Embracing Cost Management Discipline – Unveiling the Hidden Benefits of Zero-Based Budgeting (ZBB). Deloitte Canada, 2023.
- Unilever plc: Annual Report and Accounts 2018. London, 2019.
- Just-Food: Unilever sets new margin target with help from zero-based budgeting. London, 2017.
- Deloitte Denmark: Is it time to manage cost strategically and radically through Zero-Based Budgeting? Deloitte CXO Board Blog, 2023.